Die Entwicklung eines städtischen Raums ist eine komplexe Angelegenheit. Natürlich sind da die technischen, technologischen und räumlichen Erfordernisse. Es gibt aber auch soziale Aspekte: Die Stadt als lebendiger und gemeinsamer Lebensraum ist bevölkert von einer Vielzahl unterschiedlichster Beteiligter. Aus diesem Grund setzt AGORA im Rahmen seiner Projekte häufig auf die Mitarbeit von Soziologen, die ihr Know-how und ihre Vision einbringen.
Einer von ihnen ist Mathieu Berger, Professor an der UC Louvain, assoziierter Forscher des stadtsoziologischen Labors der EPFL Lausanne und Mitarbeiter des Stadtplanungsbüros CityTools. 2019 nahm er als externer Experte an dem von AGORA organisierten Ideenworkshop für das Stadt- und Landschaftskonzept des zukünftigen Quartier Alzette auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerks Esch-Schifflange teil. Hier erzählt er uns von seinen Erfahrungen und erläutert, welchen Beitrag die Soziologie in der Stadtplanung leisten kann.

Stadtplanung im Stil von AGORA: Expertengremium in Klausur oder öffentliche Diskussion?
Der Ideenworkshop von AGORA macht deutlich, dass das Unternehmen verstanden hat, wie wichtig es bei einem Stadtentwicklungsprojekt dieser Größe ist, möglichst viele beteiligte Akteure mit ins Boot zu holen. Das gilt insbesondere für Anwohner, Vereine und Verbände, mit denen ein anhaltender öffentlicher Dialog geführt werden muss. Aus diesem Grund kamen vier konkurrierende internationale Teams aus Stadt- und Landschaftsplanern für eine Woche zusammen, um gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten, unter den Augen der zuständigen Experten, aber auch der Bürger, die eingeladen waren, an verschiedenen Stellen des Prozesses ihre eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. Ich persönlich war als Mitglied des Expertengremiums beteiligt und konnte einen soziologischen Blick auf die Dinge werfen.

Die soziologische Perspektive in der Stadtentwicklung: nur oberflächlicher Beitrag oder notwendige Expertise?
In diesem Punkt kann ich natürlich nicht neutral sein! Ich denke aber tatsächlich, dass es erforderlich ist, die soziologische Komponente mit einzubeziehen. Es erscheint mir seltsam, Erkenntnisse über Lebensgewohnheiten und die Funktionsweise des gesellschaftlichen Miteinanders nur als oberflächlichen Beitrag zu sehen, wenn es darum geht, den städtischen Raum neu zu erfinden. Aufgabe des Soziologen ist es ja auch, im Bedarfsfall an den öffentlichen und gemeinschaftlichen Charakter städtischer Räume zu erinnern und Architekten und Stadtplaner zu unterstützen, wenn darüber nachgedacht wird, welche Eigenschaften ein öffentlicher Raum aufweisen muss, damit er für alle zugänglich und nutzbar ist.

Stadtplanung: Patentrezept oder Maßarbeit?
Patentlösungen funktionieren hier nicht, weil nicht alle Menschen gleich sind! Es ist wichtig, die unterschiedlichen Perspektiven zukünftiger Nutzer (Arbeiter, Bewohner, Frauen, Kinder, Senioren usw.) zu berücksichtigen und diese Komplexität mit ins Projekt zu integrieren. Was den Konsultationsprozess angeht, muss man zwischen den verschiedenen Interessengruppen unterscheiden und sich mit jeder Gruppe einzeln austauschen. Auf diese Weise kann man das Mosaik der zukünftigen Nutzer und der möglichen Nutzungsarten zusammensetzen. Diese Aspekte zu ignorieren, birgt ein großes Risiko: Das gesellschaftliche Leben könnte so Schaden nehmen, was dem Projekt nicht zuträglich wäre.

Auf welche Arten kann der Soziologe hier eingreifen?
Glücklicherweise sind ja auch wir Soziologen nicht alle gleich, daher gibt es auch nicht nur eine Art und Weise, eine soziologische Komponente in ein Stadtprojekt einzubringen. Im Grunde gibt es sogar mindestens vier Ansätze:
Der quantitative Ansatz.
Dieser Ansatz besteht darin, soziodemografische Daten und Erkenntnisse zu nutzen, um eine makrosoziale und objektivierende Beschreibung der betreffenden Bevölkerung auszuarbeiten: Struktur, Zusammensetzung, Entwicklung, Bedürfnisse usw. Dies erfordert in der Regel sozialgeografische und kartografische Kompetenzen: Um die Bevölkerung im entsprechenden Territorium zu kartieren, müssen die jeweiligen Daten räumlich zugeordnet werden.
Der qualitative Ansatz.
Dieser Ansatz basiert auf Dialog und Analyse des Austauschs mit den Akteuren, insbesondere der betroffenen Bevölkerung. Dabei kann es sich um mehr oder weniger tiefgehende Einzelgespräche, Online-Befragungen oder Gruppendiskussionen (Fokusgruppen) handeln: Man identifiziert unterschiedliche Nutzergruppen und befragt sie zu ihren Ansichten und Erfahrungen im Hinblick auf die jeweiligen Räume. Aufgabe des Soziologen ist hier eher die Auslegung der entsprechenden Antworten.

Der ethnografische Ansatz.
Hier geht es um die mikrosoziologische Beobachtung der Nutzung städtischer Räume und der Interaktionen zwischen den verschiedenen Nutzern. Für mich persönlich ist das der spannendste Ansatz. In letzter Zeit habe ich mich intensiv mit der „Stadt aus Kindersicht“ beschäftigt, beobachtet und detailliert beschrieben, wie kleine Kinder die jeweiligen Orte nutzen und mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Raum interagieren. Dieser beobachtende Ansatz kann wichtige Informationen für den Designprozess liefern.
Der vermittelnde Ansatz.
Das ist eine relativ übliche Methode. Hier kommt der Soziologe weniger als Experte oder Wissenschaftler ins Spiel, sondern eher als Vermittler zwischen den Beteiligten: Er ist für die Bürgerbeteiligung zuständig, die für eine Abstimmung zwischen Entwicklern und zukünftigen Nutzern sorgen soll.

Rezept für eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung: offenes Gespräch zwischen Bewohnern und Delegierten oder interdisziplinärer Austausch?
Ich glaube, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor darin besteht, möglichst viele unterschiedliche Akteure in einen möglichst intensiven Dialog zu bringen. Beim Quartier Alzette ist das gelungen: AGORA hat es geschafft, rund hundert Teilnehmer für eine Woche unter ein und demselben Dach zusammenzubringen: Stadtplaner und Architekten, externe Experten, Abgeordnete, Anwohner, Vereine und Verbände… Sie alle kamen zu verschiedenen Workshops und Standortbegehungen zusammen.

Leider beschränken sich partizipative Verfahren zu häufig allein auf die Anwohner. Das reicht aber nicht. Hier wurde durch die beeindruckende Zahl der Teilnehmer sowie die Organisation des Dialogs über die gesamte Woche deutlich, dass eine echte Diskussion gewünscht war, um letztlich gemeinsam ein Projekt zu entwickeln, das von möglichst vielen Beteiligten mitgetragen wird. Dieser von AGORA organisierte Workshop, der eine Mischung aus Wettbewerb und Zusammenarbeit zwischen den konkurrierenden Entwicklungsteams darstellte, gleichzeitig aber auch auf den öffentlichen Dialog mit den Bürgern abzielte, war natürlich kosten- und arbeitsintensiv, doch die Vorteile im Hinblick auf die Projektqualität und die Akzeptanz der Bevölkerung wiegen das letztlich deutlich auf.

Der partizipative Prozess: eine einmalige Angelegenheit oder eine langfristige Strategie?
Wenn es um Bürgerbeteiligung geht, ist eine kontinuierliche Komponente von entscheidender Bedeutung. Der Vorteil des beschriebenen Workshops liegt darin, dass es sich hier um einen dynamischen und langfristigen Prozess handelte und nicht nur um eine oberflächliche und einmalige Angelegenheit von wenigen Stunden. Diskussionen, Standortbegehungen, Meilensteine, eine permanente Abstimmung zwischen Entwicklungsteams und der Jury, die Anwesenheit der Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen, vom ersten Moment bis zur finalen Präsentation der Projekte, der Wunsch, mit der Qualität des Prozesses ebenso zu überzeugen wie mit dem daraus resultierenden Konzept, und die Ernsthaftigkeit der Organisation und der praktischen Umsetzung des Austausches haben dabei einen enormen Unterschied ausgemacht.
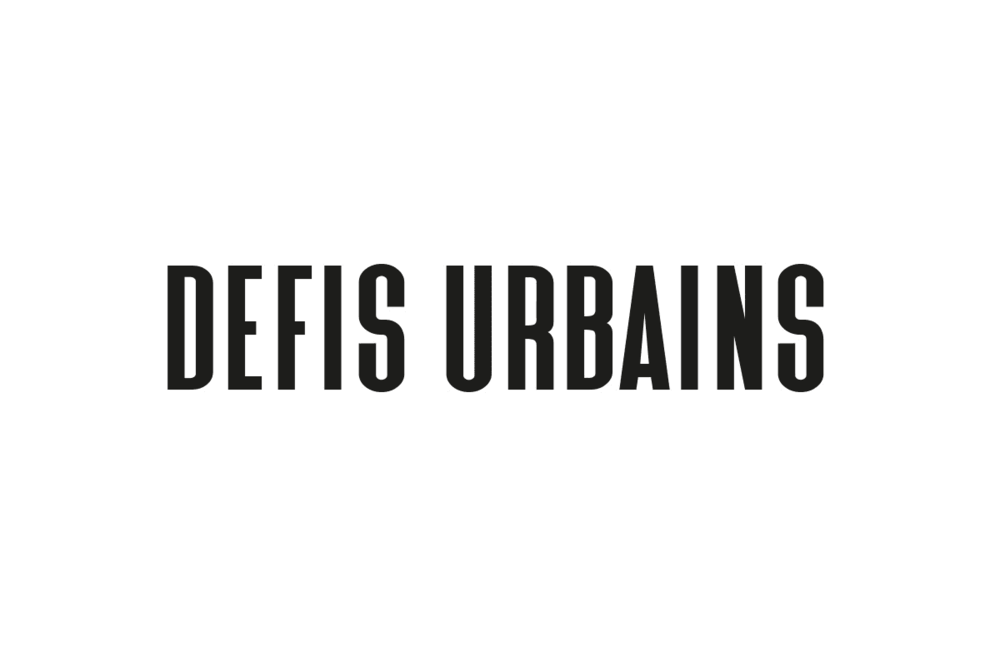
Interviews von Agora-Mitarbeitern, -Partnern und -Experten, mit der Serie „Défis urbains“ entdecken Sie die von AGORA initiierten und gelebten Werte.
Entdecken Sie alle Artikel dieser Serie via Klick auf das unten stehende Tag.






